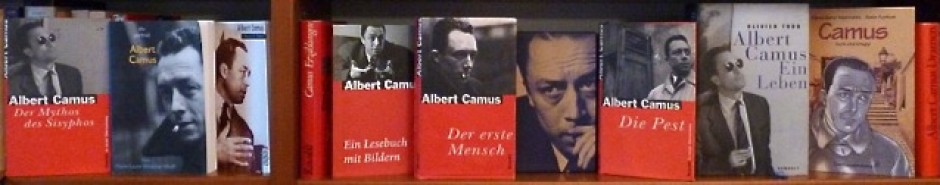Am 7. November wäre Albert Camus 110 Jahre alt geworden. Wie sehr er auch heute noch inspirieren kann, zeigte das Festival in Lourmarin. Wie sehr wir ihn brauchen, zeigt ein Blick auf das Weltgeschehen.

Shit happens. Das hätte Camus jetzt gewiss anders ausgedrückt, aber gut. Mit reichlich Verspätung, aber dann wenigstens rechtzeitig zum 110. Geburtstag wollte ich hier in aller Ausführlichkeit von dem schönen Camus-Festival in Lourmarin erzählen, allein: Meine ganzen Aufzeichnungen sind nicht mehr auffindbar. Alles von rechts auf links gedreht – aber nichts. Und dann war auch der Geburtstagstag schon vorbei. Sehr wahrscheinlich sind die Notizen sogar schon in Frankreich im Mietwagen zurückgeblieben.

So kann ich meine Erinnerungen nicht wirklich teilen: an den sehr schönen literarisch-musikalischen Abend in der evangelischen Kirche von Lourmarin oder an das Rockkonzert der zauberhaften jungen „absurd heroes“, die sich sehr ernsthaft mit Gedanken von Camus beschäftigt haben. An drei wirklich profunde und noch dazu überaus engagiert präsentierte Vorträge von den drei großartigen Frauen Zakia Adelkrim, Anne Prouteau und Alice Kaplan. An die Vorab-Buchpräsentation des Dictionnaire Amoureux d’Albert Camus (der inzwischen erschienen ist) des Figaro-Journalisten Mohammed Aissaoui und auch nicht an den sehr schönen Film von Elisabeth Kapnist Maria Casarès, Albert Camus, Toi ma vie, der die Liebesgeschichte der beiden aus der Perspektive von Maria erzählt. Das Programm und die Organisation lagen in den Händen von Catherine Camus‘ Tochter Elisabeth Maisondieu-Camus, von Hause aus Rechtsanwältin in Paris, die inzwischen auch den Vorsitz der Fondation Albert Camus von ihrer Mutter übernommen hat, und die die Rencontres ganz offensichtlich weg von der öffentlichen wissenschaftlichen Fachtagung hin zu einem Publikumsfestival ausgerichtet hat. Wobei der Vortragsvormittag von hoher Qualität war, der jeder Tagung zur Ehre gereicht hätte – nur leider mangels Fachpublikum ohne den fruchtbaren inhaltlichen Diskurs. Dafür hat das Festival aber deutlich mehr örtliches Publikum erreicht als früher, und zudem auch mehr jüngere Menschen (Workshops in Schulen gehörten auch noch zum Programm). Eine lebendige und schöne Sache, auf die man sich schon im nächsten Jahr freuen darf, wenn das Festival-Thema Fraternité heißen wird.
Fraternité. Brüderlichkeit. Geschwisterlichkeit, meinetwegen (ich für meinen Teil habe schon als Kind voller Inbrunst bei Beethoven mitgesungen „alle Menschen werden Brüder…“ und mich dabei nie ausgeschlossen gefühlt). Was für ein schwergewichtiges Thema, heute nicht weniger als in jenen Tagen, als Camus die Briefe an einen deutschen Freund schrieb. Oder seinen Brief an einen algerischen Aktivisten im Jahr 1955. Es geht darin um die Vorstellung einer gemeinsamen Heimat von Arabern und Algerienfranzosen, die sich in blutigem Kampf gegenüberstanden.
Vor knapp zehn Jahren, im Sommer 2014, habe ich diesen Brief hier in Gänze zitiert und jeweils bei Arabern und Franzosen Lücken im Text gelassen, die man beinahe beliebig füllen kann. Schon damals war der Anlass die Eskalation von Gewalt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas. Damals dauerte der blutige Konflikt rund vier Wochen, schon damals gab es eine hohe Anzahl von Opfern – doch übertrifft das Geschehen von heute den Schrecken von damals um ein Vielfaches, und diesmal ist ein Ende nach vier Wochen nicht in Sicht. Und wieder einmal oder erst recht bestürzt es, wie passend die Worte von Camus heute wieder erscheinen.
„Man könnte meinen, Irrsinnige hätten, toll von Wut und der Zwangsehe bewusst, der sie nicht entfliehen können, beschlossen, eine tödliche Umarmung daraus zu machen. Gezwungen, miteinander zu leben, und unfähig, eins zu werden, beschließen sie, wenigstens zusammen zu sterben. Und ein jeder verstärkt durch seine Maßlosigkeit die Gründe und die Maßlosigkeit des anderen, so dass der Todessturm, der (das) Land heimsucht, sich nur noch bis zur allgemeinen Vernichtung steigern kann (…)“. (1)
Dass Camus‘ Worte immer wieder von neuer Aktualität eingeholt werden, kann pessimistisch stimmen. Einmal mehr hat sich der Fels der Hoffnung als Stein des Sisyphos erwiesen. Aber was bleibt, als die Anstrengung, ihn immer wieder hinaufzustemmen? Auch Camus hat damit nie aufgehört. Er schließt seinen Brief an Aziz Kessous mit folgenden Worten:
„Ich will mit all meine Kräften glauben, dass der Friede sich über unseren Feldern, unseren Bergen, unseren Küsten erheben wird und dass dann die in Freiheit und Gerechtigkeit versöhnten […] sich dazu überwinden, das Blut, das sie heute trennt, zu vergessen. An dem Tag werden wir, die wir gemeinsam in Hass und Verzweiflung verbannt sind, gemeinsam eine Heimat wiederfinden“. (1)
Zu meinem Beitrag mit dem gesamten Brief geht es hier: Albert Camus und ich schreiben einen Brief
Schalom und Salaam Aleikum.
(1) Albert Camus, Brief an einen algerischen Aktivisten, in: Fragen der Zeit, Übersetzung von Guido G. Meister, Rowohlt, Reinbek b. Hamburg 1968, S. 80ff.
P.S.: Eine Neuigkeit kann ich immerhin noch verkünden, die Camus-Freunde interessieren dürfte: Nach der Veröffentlichung der Briefe Camus-Casarès arbeitet Catherine Camus gerade an der Herausgabe des Briefwechsels von Albert Camus und seiner Frau Francine. Das äußerte die Tochter öffentlich beim Festival in Lourmarin. Man darf gespannt sein!