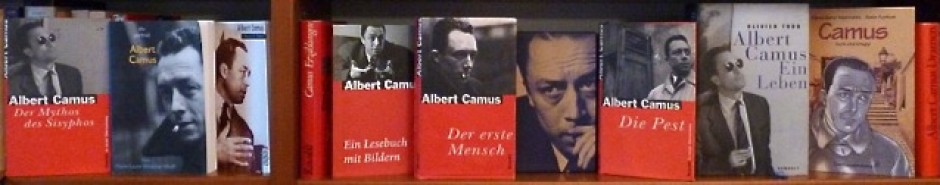Albert Camus‘ Der Fremde erstmals als Musiktheater: Musik und Inszenierung geben Geist und Sinnen gleichermaßen Futter.

Zur Uraufführung am 30. Juni hatte ich es leider nicht geschafft, aber jetzt hatte ich die Freude, doch noch eine Vorstellung der Kammeroper von Cecilia Arditto Delsoglio und Annette Müller nach Camus‘ Roman Der Fremde im Studio Werkhaus des Nationaltheater Mannheim erleben zu können. Und eine Freude war es wahrhaftig. Das Team Delsoglio/Müller hatte mit seinem Konzept (und einer auskomponierten Szene) den vom Mannheimer Theater ausgeschriebenen Kompositionswettbewerb gewonnen – und auch ohne die anderen Einreichungen zu kennen, kann man sicherlich sagen: Die Jury hat eine gute Wahl getroffen. Das Ergebnis überzeugt und macht, siehe oben: Freude.
Vor vielen Jahren gab ich auf die Frage, was meine Kriterien für eine Theaterrezension seien, kurz und bündig zur Antwort: „Wenn ich nicht geheult, gelacht oder nachgedacht habe, war’s nicht gut“.
Nun ist der Mörder Meursault in seiner ganzen indifférence sicher keiner, um den man Tränen vergießen würde. Sonderlich viel Anlass zum Lachen gibt die Geschichte auch nicht her. Zum Nachdenken bietet sie freilich reichlich Stoff, aber dazu bräuchte es keine Opernfassung. Ich muss konstatieren: Mein einstiger Dreifach-Prüfstein taugt hier nichts. Vielleicht hatte ich dabei einfach die Freude vergessen, das Vergnügen bereitende sinnlich-intellektuelle Erlebnis an sich.
„Ein sinnlich-intellektuelles Erlebnis“? Ist das nicht ein hölzernes Eisen? Nein, keineswegs. Cecilia Arditto Delsoglio hat sich nach eigenen Worten von Anfang an auf die sinnliche Dimension des Textes von Camus konzentriert – und bleibt dabei ganz nah am Protagonisten Meursault. Der nimmt die Welt und das Geschehen um sich herum über die Sinne wahr, ohne nachzudenken, ohne zu urteilen. Seine Welt ist die schlichter sinnlicher Vergnügungen im eher öden, aber ohne Verdruss erlebten Gleichmaß der Tage. Camus erschafft in seiner Erzählung die Atmosphäre drückend heißer algerischer Sommertage voller Licht und Hitze, angefüllt mit Farben und Geräuschen. Und der Komponistin gelingt es, diese sinnliche Dimension in Musik (Töne, Klänge) umzusetzen, während die Regie darauf verzichtet, auch nur den kleinsten Ansatz einer psychologischen Interpretation für diesen seltsamen Charakter Meursault anzubieten. Und genau das überzeugt. Bariton Joachim Goltz im hellen Sommeranzug gibt den Meursault mit klangvoller Stimme aber ohne jedwede Dramatik und schafft es tatsächlich über das ganze Geschehen hinweg, den gleichen völlig neutralen Gesichtsausdruck aufrechtzuerhalten, in den sich im zweiten Teil allenfalls ein wenig Erstaunen mischt.

Viel Platz für Aktion ist nicht auf der kleinen Studiobühne. Auch von einem Bühnenbild kann im traditionellen Sinne kaum die Rede sein. Zwischen dem auf der Bühne platzierten Orchester (links und rechts je sieben Musiker:innen) bleibt mittig nur wenig Spiel-Raum. Darin zu Anfang, weiß auf weiß, ein schlichtes Podest, auf dem schwarz gekleidet Meursaults verstorbene Mutter aufgebahrt liegt. In der Schwimmbadszene wird es im Boden versenkt zum Bad, wo Meursault auf Marie trifft; später reichen ein schlichter weißer Tisch und Stühle bzw. eine ebenfalls weiße Bank für alle weiteren Szenen. Zu keinem Zeitpunkt werden irgendwelche naturalistischen Bühnenillusionen geschaffen. Die in verschiedenen Farben beleuchtete Rückwand dient als Projektionsfläche für den Text, der anders als bei üblicher Opern-Übertitelung nicht parallel die (in französisch) gesungenen Worte übersetzt, sondern eins zu eins aus der deutschen Fassung von Der Fremde übernommen ist. Er erklärt und ergänzt somit das Bühnengeschehen, bzw. bringt den Zuschauer dazu, das Gesehene in eigener Imagination zu ergänzen.

Foto: Maximilian Borchardt
Klingt in dieser Beschreibung alles ein bisschen spröde und gar nicht so sehr nach „sinnlich-intellektuellem Vergnügen“? Aber das ist gerade das Erstaunliche: Wie es dennoch gelingt. Zuvörderst natürlich durch die Musik, für die mir als musikalischer Laie die Mittel angemessener Beschreibung oder gar kompetenter Analyse fehlen. In der Wirkung jedenfalls ist sie ungemein dicht, komplex, spannend, flirrend, verwoben mit Alltagsgeräuschen wie dem Rascheln der Tageszeitung, dem Surren von Ventilatoren oder der Luftschwingung von Fächern, mit denen die Musiker:innen sich in der Gerichtsszene Luft zufächeln und damit zugleich zum Publikum im überhitzten Gerichtssaal werden. So wie einige Musiker in der Beerdigungsszene ihre Plätze verlassen und den Sarg umkreisend zu Spielern werden, die den (imaginären) Trauerzug anführen. Musikalische und szenische Funktionen verschwimmen, Text und Gesang laufen nicht parallel, alles greift ineinander und verzahnt sich, ohne dass das eine das andere einfach nur abbildet. Im Programmheft-Interview zitiert Cecilia Arditto Delsoglio die Aussage Robert Bressons „Gib nicht den Augen, was du den Ohren gibst“ (1). Dieser Maxime folgend gibt die Inszenierung Geist und Sinnen des Zuschauenden und Zuhörenden permanent Futter. Und weiter im Interview: „Wir versuchen, sehr stark das >Inter<- zu erforschen, im Sinne des Zwischenraumes. Damit ist Interaktion zwischen Sänger*innen und Instrumentalist*innen, zwischen Klang und Raum, zwischen Ton und Text gemeint. Wir versuchen, auf allen unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig zu erzählen und nicht einer Ebene die Deutungshoheit zu übertragen“ (2). Das gelingt vortrefflich und macht das Ganze so spannend.

Selbstredend, dass die exzellenten Sängerinnen und Sänger entscheidenden Anteil am gelungenen Ganzen haben. Neben dem schon erwähnten Joachim Goltz/Meursault ist es Amelia Scicolone als Marie, die aussieht, als wäre sie der Graphic Novel von Jacques Ferrandez entsprungen (mithin entzückend) und mit glasklarem, bis in höchste Höhen reichenden Sopran Frische und Unbekümmertheit ihrer Figur ausdrückt. Unsicherheiten gegenüber Meursaults merkwürdigem Verhalten lacht sie mit spitzen, stakkatohaften Koloraturen weg. Patrick Zielke überzeugt mit nuancenreichem Bass im ersten Teil als Heimleiter und windiger Kleinkrimineller Raymond (Meursaults Nachbar) ebenso wie als Untersuchungsrichter in schwarzer Robe und geradezu sich selbst aufblähender Bedeutung im zweiten Teil. Slavica Božić (mit schönem Mezzo) übernimmt verschiedene, zum Teil erzählerische Funktionen und schafft so einen stimmlichen Ausgleich im männerlastigen Kosmos von Der Fremde.

Bei aller Begeisterung und dem völligen Einverständnis mit dem ästhetischen Zugriff auf die Textvorlage – am Ende standen zwei dicke fette Fragezeichen in meinen Augen. Klar ist: Die Umsetzung eines Romans in ein Bühnenwerk erfordert immer Textstreichungen an der ein oder anderen Stelle. Dramaturgische Entscheidungen, bei denen diverse Aspekte eine Rolle spielen. Worauf muss, worauf will man verzichten? Die Aufführungslänge bei einem Stück ohne Pause spielt eine Rolle, die Umsetzbarkeit innerhalb eines Konzepts, braucht man eventuell weitere Darsteller, erfordert etwas zusätzliche Mittel etc. etc. Über weite Strecken habe ich absolut nichts vermisst – die ganze Geschichte ist im Prinzip da. Aber dann – – – fehlt die komplette Szene, in der Meursault in seiner Gefängniszelle Besuch vom Anstaltsgeistlichen bekommt, der ihn zur Reue bewegen will. Eine absolut entscheidende Szene für die Entwicklung dieser Figur Meursault, sein Ausbruch aus der Gleichgültigkeit, die Stunde des Bewusstseins, seine Abrechnung mit dem ganzen bigotten und verlogenen System einer Gesellschaft, die ihn letztlich zum Tode verurteilt, weil er auf der Beerdigung seiner Mutter nicht geweint hat.
Warum diese wichtige Szene weglassen, während man kleinen Nebengeschichten wie dem alten Salamano und seinem Hund oder Meursaults Fund der Tageszeitung mit der Geschichte von Das Missverständnis Raum gelassen hat? Nach der Vorstellung hatte ich Gelegenheit, Cecilia Arditto Delsoglio danach zu fragen. Natürlich hätten die Dramaturgin Annette Müller und sie darüber nachgedacht, und zunächst einmal sei es eine ökonomische Frage bezüglich der Reduzierung der Charaktere und der Textmenge gewesen, erklärt die Komponistin. Vor allem aber hätten sie das große Thema der Religion ausklammern wollen: „We wanted to keep it more universal.“ Die erwähnten kleinen Nebengeschichten dagegen seien so wunderbar und poetisch in ihrer Absurdität und würden dem Ganzen Farbe verleihen, die man in einer Oper eben auch brauche. – Verstehe ich, hätte aber trotzdem gegen ein paar zusätzlich Minuten umwillen der Priester-Szene ganz und gar nichts einzuwenden gehabt.
Mein zweites Fragezeichen: Die eingeblendeten Texte, die elementarer Bestandteil der Inszenierung sind, sind eins zu eins aus der deutschen Übersetzung übernommen (3). Collagehaft zusammengesetzt, aber nicht verändert. „We didn’t change a Komma„, betont die Komponistin, als ich zu meiner Frage ansetze. Ja – aber warum in aller Welt streicht man dann die letzten Worte von Meursault, mit denen der Text endet? Meursault wünscht sich am Ende für seine Hinrichtung nicht einfach „viele Zuschauer“, sondern „viele Zuschauer, die ihn mit Schreien des Hasses empfangen.“ Das ist keine Kleinigkeit.
Dies sei eine Entscheidung der Dramaturgin gewesen, sagt Cecilia, aber die kann ich leider nicht fragen. Ich vermute, dass diese Entscheidung mit der Umschiffung des Themas „Religion“ zusammenhängt, da sich die Aussage Meursaults als Referenz zur Kreuzigung Jesu auslegen lässt. Im Roman kommt dieser Satz aber unvermittelt wie ein mächtiger, dissonanter Schlussakkord daher, der einen in dem Moment völlig unvorbereitet trifft und zunächst mal mit einem großen Rätsel zurücklässt. Mag sein, dass ein solcher Schluss das Opernpublikum noch mehr irritiert hätte als die Leserschaft – aber das Publikum mit einem solchen Rätsel nach Hause zu schicken, an dem man noch lange herumknabbern kann, hätte Camus wohl mehr entsprochen. Und mir besser gefallen.
Was der Camus-Spezialistin Fragen aufgibt, muss aber die Opernbesucher, bei denen diese erste Umsetzung von Camus‘ berühmten Roman fürs Musiktheater hervorragend angekommen ist, nicht gleichermaßen interessieren. Deshalb will ich damit auch nicht enden. Ich denke vielmehr an jene Momente gegen Ende des Romans, in denen Meursault in seiner Gefängniszelle bewusst wird, dass er glücklich war und immer noch glücklich ist: Wenn er die Trompete eines Eisverkäufers hört und ihn Erinnerungen überfallen an ein Leben, in dem er die „ärmsten und hartnäckigsten Freuden“ gefunden hatte, oder wenn er in seiner Zelle die aufsteigenden Düfte aus „Nacht, Erde und Salz“ in sich aufsaugt und empfänglich wird für die „zärtliche Gleichgültigkeit der Welt“. Hier mischt Camus‘ in seinen klaren, völlig schnörkellosen Erzählstil von Der Fremde lyrische Töne, die aus seinen literarischen Essays stammen könnten. Cecilia Arditto Delsoglio findet für diesen Kunstgriff die perfekte musikalische Entsprechung mit wunderbaren melodiösen, tonalen, erzählerischen Klängen, die gegenüber der Gesamtkomposition wie ein Fremdkörper wirken. Als Zuhörer ist man hier am Ende ganz nah bei Meursault und teilt seine glücklichen Erinnerungen und seinen Einklang mit der Welt. Und das ist schließlich auch ein sehr schönes Gefühl, mit dem man nach Hause geht.
Wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich mir diese Inszenierung sofort noch einmal anschauen – und sicherlich noch viel mehr darin entdecken.
Letzte Vorstellung am Samstag, 13. Juli 2024, 19 Uhr (nur noch Restkarten). Infos (auch zu allen Beteiligten), Pressestimmen und Trailer auf der Seite des Nationaltheaters Mannheim.
BESETZUNG:
Komposition und Co-Regie: Cecilia Arditto Delsoglio. Musikalische Leitung: Pierre-Alain Monot. Regie und Bühne: Annette Müller. Kostüme: Oliver Kostecka. Dramaturgie: Daniel Joshua Busche, Jan Dvořák. Sopran: Amelia Scicolone. Mezzo: Slavica Božić. Bariton: Joachim Goltz. Bass: Patrick Zielke. Orchester des Nationaltheaters Mannheim.

Anmerkungen:
(1) Im Gespräch mit Daniel Joshua Busche, Programmheft zur Uraufführung am Nationaltheater Mannheim am 30.6.2024, S. 21; (2) ebd. S. 22; (3) In neuer Übersetzung von Uli Aumüller, Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek b. Hamburg 2024
VERWANDTE BEITRÄGE:
Meursault singt! Albert Camus‘ „Der Fremde“ als Kammeroper am Nationaltheater Mannheim
Nationaltheater Mannheim schreibt einen internationalen Kompositionswettbewerb zu Camus‘ „Der Fremde“ aus
„Der Fremde“ als Graphic Novel – beeindruckend umgesetzt von Jacques Ferrandez (75 Jahre „Der Fremde“ 2)
… und alle weiteren Beiträge im Blog unter dem Stichwort „Der Fremde“